|
| |
|
 |
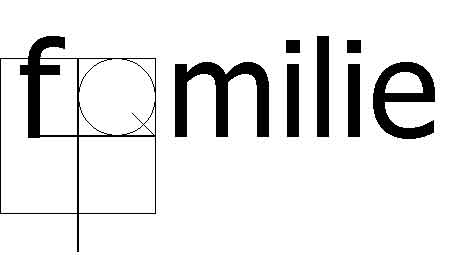 |
| Das
Deutsche Universalwörterbuch von Duden definiert Familie als
"aus einem Elternpaar und mindestens einem Kind bestehende
Gemeinschaft". Der Begriff der Familie partizipiert hier wie der zu
seiner Bestimmung herangezogene der Gemeinschaft an einer positiven
Besetzung der Sozialität. Seine Abgrenzung gegen das Individuelle
provoziert die Konstitution von primären Verbindungen wie beispielsweise
die Idee der Elternschaft. Statt Gemeinschaft würden Begriffe wie Gruppe
oder System das Faktum der Verbindungen gleich beschreiben, nicht
aber die Intention. Sprache beruht auf konventionellen Aussageabsichten.
Wer im Deutschen - mit Duden - Familie sagt, meint eine
Eltern-Kind-Verbindung, die in der Regel als biologisch begründet
verstanden wird; wer von Eltern spricht, meint Vater und Mutter
(meist in dieser Reihenfolge!); wer Eltern in ihrem Bezug zu Kindern
sieht, meint ein Sorgeverhältnis; wer ein Kind in seinem Bezug zu Eltern
betrachtet, meint Abhängigkeit in ihren positiven wie negativen Aspekten.
Obschon sich die Familie zunächst in der Gesellschaft ausgegrenzt
vorfindet, insofern Gesetze und Normen sie als ein eigenes (Sub-)System
definieren, führt ein sozialisiertes Bedürfnis nach Autonomie zur
Introjektion der Konditionen. Sorgerecht und -pflicht werden zu eigener
Sorge, biologische und rechtliche Verbindungen werden emotional besetzt,
Steuervergünstigungen und Kindergeld von gesellschaftlichen Anreizen in
Belohnung autonomen Handelns umgewertet.
|
|

|
Ich weiß, dass dies eine pessimistische Sicht
auf die Liebe zwischen Eltern und Kind ist. Dass sie mir widerstrebt,
macht es nur leichter, die Familie aus sich heraus sich konstituieren zu
sehen. Ich sehe den genetisch kodierten wie sozialisierten Wunsch, Kinder
zu 'haben', Kinder zu lieben, ihr 'Urvertrauen' zu akzeptieren, elterliche
Sorge und kindliche Abhängigkeit für natürlich zu erklären. Ich sehe
die Hoffnung und den Narzissmus, in Kindern weiterzuleben, ein neues
Kapitel der eigenen Geschichte zu schreiben, nochmals an ihrer Naivität
teilzuhaben und die Zeit zu gewinnen, die angeblich Wunden heilen macht.
Jetzt aber ist die Last der Gesellschaft zu meiner eigenen geworden. Ich
rechtfertige die Konditionen, die ich nicht verantworten kann. Diesen Prozess
durchlebe ich, um die Ausgrenzung aus der Gesellschaft zu ertragen. Sie
sagt: Du und Dein Kind!, wenn sie meine Leistung für es
anerkennt, wenn sie über meine Sorge urteilt und wenn sie mein Versagen
festschreibt, weil mein Kind ihr nicht genügt.
Ich sage: Ich und mein Kind!, wenn ich stolz auf es bin,
wenn ich mich selbst für es vergesse, wenn ich unsere Einsamkeit nicht
aushalten kann und mir einrede, wir beide wollten es so. So-Sein
wird Ich-Sein um der Illusion der Autonomie willen, die mich die
Gesellschaft lehrte. Damit entriss sie mich der Familie, der sie mich überantwortete,
als ich in die Konvention der Gesellschaft noch keine Einsicht und für
ihre Konstitution noch keine Bedeutung hatte. Andeutungsweise sollte diese
Verschiebung in Niklas Mutter erkennbar geworden sein.
|
| In
wissenschaftlichem Verständnis unterscheidet Schneewind
(1995)* in Anlehnung an Karpel
und
Strauss fünf Definitionen von Familie: 1) Die "biologische
Familie" als Summe der Verbindungen aufgrund von Blutsverwandtschaft;
2) Die "rechtliche Familie" als Summe von Verbindungen auf
Grundlage des Rechtssystems; 3) Die "funktionale Familie" als
Summe von Verbindungen des alltäglichen Zusammenlebens; 4) Die
"wahrgenommene Familie" als Summe von Verbindungen, die die
einzelnen Familienmitglieder zueinander sehen; 5) Die "Familie mit
langfristigen Verpflichtungen" gemessen an der Stabilität ihrer
Verbindungen, welcher Art diese auch sind. |
Von
meinem siebten Lebensjahr an, als ich zum
ersten Mal nach Dänemark kam, bin ich, bis ich
dreizehn war und aufgab, öfter abgehauen, als
ich mich erinnern kann. Zweimal kam ich bis
Grönland, einmal weiter bis nach Thule. Man muss
sich nur an eine Familie anhängen und aussehen,
als säße die Mutti im Flugzeug fünf Sitze weiter vorn,
oder sich ein bisschen weiter hinten in die Schlange
stellen. Die Welt ist voller Räubergeschichten von
entflogenen Papageien, entlaufenen Perserkatzen
und französischen Bulldoggen, die wunderbarerweise
zu Herrchen und Frauchen in die Frydenholm Allee
zurückgefunden haben. Das ist nichts gegen die
Kilometer, die Kinder auf ihrer Suche nach einem
ordentlichen Leben zurückgelegt haben.
Peter
Hoeg
Fräulen Smillas Gespür für Schnee
rororo
(1996) S.71
|
|
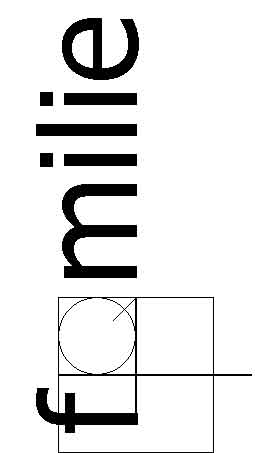
|
Die
Biologie beschreibt vererbte irreversible Konditionen: die physiologische
und die auf ihr aufruhende psychologische Verfasstheit der
Familienmitglieder, ihre Blutsverwandtschaft und auf Grundlage dieser
Verwandtschaft geteilte soziale Bedingungen. Das Recht beschreibt
gesellschaftliche Konditionen: den rechtlichen Status der einzelnen
Familienmitglieder und der Familie als Subsystem des Gesellschaftssystems,
staatlich sanktionierte Verbindungen, die Verfügbarkeit suprafamilialer
Ressourcen und konventionelle Entwicklungsverläufe von einzelnen und der
Familie insgesamt. Die Funktionalität beschreibt faktische Konditionen: wer
mit wem wie zu tun hat. Die Wahrnehmung beschreibt
subjektive Konditionen: was das einzelne Familienmitglied 'sehen' kann,
was es nicht 'sehen' will und welche 'Ansichten' es glaubt, mit anderen zu
teilen. Die Persistenz beschreibt logische Konditionen: insofern die
Identifikation der Familie als abgegrenztem System nur durch Veränderung
geschieht, ist Dauer eine Notwendigkeit. |
|
Die
einzelnen Definitionen sind keine Alternativen, sondern konstituieren
Familie in unterschiedlichen Perspektiven. Eine umfassende Beschreibung
eines Familiensystems muss seine Verhältnisse also in den Sichtweisen
nachvollziehen, in denen es sich reflektiert und unreflektiert begründet.
Zugleich schafft die Beschreibung Familie neu, da sie eine ihrer
Konditionen ist. Die Beratungsstelle, der Psychiater, das Jugendamt haben
Niklas und seine Familie verändert. Sie konnten die Verhältnisse zu
keinem Zeitpunkt sehen, ohne sie zu gestalten: Sie blieben eine Möglichkeit,
als der Vater den Kontakt zu ihnen ablehnte; sie waren ein Begriff von
Niklas Andersartigkeit; sie warfen der Mutter kein Versagen vor, und doch
manifestierten sie es in ihrer Gegenwart. Vom Wort als Ideologie über die
Verbindungen bis zur vermeintlichen Beschreibung ist Familie ein
Produkt von Konditionen. Es ist kein Respekt, Perspektiven als autonome
Konstruktionen auszugeben. Die Verhältnisse sind anders, weil ich da
bin, nicht weil ich sie anders sehen will. |

|
|
Fürsorge ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Klaus A. Schneewind
Familienentwicklung
in: Oerter / Montada (Hrsg.)
Entwicklungspsychologie
PVU (1995) S.129 |
|
